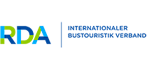Als junger Rucksackreisender hatte es mich vorwiegend in ferne Länder gezogen, nach Nordafrika und Nord-und Mittelamerika. Später wollte ich vor allem meine europäischen Wurzeln näher „behandeln“ , diesmal mehr unter den Aspekten Kunst, Kulturlandschaft, Architektur, Städtebau, Essen nicht zu vergessen. Fast jeden freien Tag der letzten Jahrzehnte war ich unterwegs, besonders oft in Frankreich (wo ich schon als 15jähriger Austauschschüler war), auf der iberischen Halbinsel und immer wieder, von oben nach unten und umgekehrt, in Italien, ohne das die Kunstgeschichte in Europa ja gar nicht denkbar ist.
Seit meinem Unruhestand bin ich 20.000 km mit dem Rad durch Europa gefahren. Dabei merkte ich, dass Erfahrung mit Kunst und Kultur der Länder und die Freude daran nichts Privates „für den Hausgebrauch“ sein sollte. Sondern es müsste Interessierten weitergegeben und vermittelt werden. Deswegen beginne ich im „fortgeschrittenen“ (aber fitten!) Alter, für Eberhardt zu arbeiten. Darauf und auf Sie freue ich mich.
 Wanderreise Bretagne - Brise des Atlantiks
03.08. – 13.08.2024
Wanderreise Bretagne - Brise des Atlantiks
03.08. – 13.08.2024 Singlereise Frankreich - Wandern in der Bretagne
17.08. – 27.08.2024
Singlereise Frankreich - Wandern in der Bretagne
17.08. – 27.08.2024 Städtereise Florenz & Venedig
14.09. – 20.09.2024
Städtereise Florenz & Venedig
14.09. – 20.09.2024 Faszination Sardinien - Schätze von Nord nach Süd
23.09. – 02.10.2024
Faszination Sardinien - Schätze von Nord nach Süd
23.09. – 02.10.2024 Italien - Gartenkunst in der Toskana & rund um Rom
08.05. – 17.05.2025
Italien - Gartenkunst in der Toskana & rund um Rom
08.05. – 17.05.2025 Große Rundreise durch ganz Frankreich
07.06. – 22.06.2025
Große Rundreise durch ganz Frankreich
07.06. – 22.06.2025Diese Reise durch den Westen und Nordwesten Frankreichs führte uns zunächst in die Normandie, in ihre Hauptstadt Rouen an der Seine, in Seebäder und Festungsstädte an der Kanalküste, an die Orte der alliierten Landungen 1944, zum Weltkulturerbe Mont St.Michel, sodann an die zerklüftete bretonische Küste und an magische Stätten der Megalithkultur und der Artussage. Eine Fülle vor allem mittelalterlicher Zeugnisse begegnet uns, alte Ortsbilder, vor allem faszinierende Kirchen in Rouen und Caen, Mont St.Michel und auf der Rückfahrt nach Paris auch noch die Kathedrale von Chartres, der Inbegriff der französischen Kathedrale, die „Akropolis Frankreichs“ wurde sie mal genannt.
Normandie. Wie der Name schon sagt, war diese abwechslungsreiche Landschaft normannischen Herzögen und Königen untertan, Nordmännern, Skandinaviern, den Nachfahren der Wikinger also. Schon zu römischer Zeit gab es die Provinz Lugdumensis secunda in annähernd den heutigen Ausmaßen. Viele Verkehrswege sind noch älter, aus keltischer Zeit (ca.500 v.Chr.). Die Gallier, von deren Leben uns Asterix und Obelix am prominentesten erzählen, waren Kelten. Ab dem 5.Jh. kamen bereits christianisierte Franken, die Klöster und Kirchen gründeten (Rouen, Caen, Mt.S. Michel).
Ab dem 9.Jh. kamen wie gesagt die Normannen aus Skandinavien ins Land. 150 Jahre später waren es die Normannen selbst, die sich zeitweise gegen Skandinavier wehren mussten. Schillerndster Vertreter der Normannen im 11.Jh. war Wilhelm der Eroberer. Unter ihm wurden die Kathedralen von Rouen und die Klosterkirchen Jumièges und St.Etienne in Caen gegründet. Er wird aber in erster Linie mit der Eroberung von England verbunden. Sein Halbbruder, Odo von Conteville, war Bischof von Bayeux und Auftraggeber des berühmten Teppichs gleichen Namens, auf dem die Invasion Englands 1066 illustriert ist. Wilhelm landete, übrigens unterstützt vom Papst, in England, als dessen König Harold (eigentlich ein Vasall Wilhelms, der sich dann aber doch zum englischen König krönen ließ) gerade in andere Kämpfe im Norden verstrickt war. Wilhelm ließ sich Weihnachten 1066 in Westminster krönen und regierte fortan von dort. Folglich war die Normandie nur noch ein Teil seines Reiches. Nach dem Tod Wilhelms wurde Robert Kurzehose, Sohn des frz. Königs Heinrich I, Herzog der Normandie und Rufus, sein Bruder, König von England. Noch über hundert Jahre blieben Normandie und England politisch verbunden.
Etwas unübersichtlich ist die Geschichte, dass die Normandie mal von England aus regiert wurde und England von der Normandie. Das Sagen hatten auf beiden Seiten aber die Normannen.
Das 12.Jh. ist die Zeit der Plantagenets. Das Königsgeschlecht leitet sich von „planta genista“ (Ginster) ab, der sich in seinem Wappen befindet. Henry II Kurzmantel ist nach komplizierter Heiratspolitik Herrscher über das „Angevinische Reich“ (von Angers), das sich von Schottland über das heutige Westfrankreich bis hin zu den Pyrenäen erstreckt. Verheiratet ist er mit Eleonore von Aquitanien, ihr gemeinsamer Sohn ist Richard Löwenherz. Alle drei sind übrigens in der sehr sehenswerten Abtei Fontevraud an der Loire begraben, ihre Sarkophage sind Highlights der romanischen Skulptur (Eleonore liest noch als Tote die Bibel). Richard Löwenherz war erst Herzog der Normandie, dann König von England. Sein Bruder war übrigens Johann Ohneland.
Zur Absicherung seiner Herrschaft lässt er das Chateau Gaillard in Rekordzeit erbauen, dieses fällt aber 1204, lange nach dem Tod Richards, in den Besitz der mittlerweile erstarkten französischen Krone des Königs Philippe II Auguste. Damit wurde und blieb schließlich die Normandie französisch. Sie wurde anfangs wie ein erobertes Gebiet behandelt, bewahrte aber ihr ausgeklügeltes Rechts- und Verwaltungssystem.
Ab der Mitte des 14.Jh. ist die Normandie teilweise wieder englisch, es herrscht der 100jährige Krieg zwischen Frankreich und England. In diese Zeit, Anfang des 15.Jh., fällt die Geschichte von Jeanne d’Arc, der Jungfrau von Orleans, die Frankreich den Engländern entriss, dann aber an dieselben verraten und 1431 als 19Jährige auf dem Scheiterhaufen in Rouen verbrannt wurde.
Trubel gab es auch in der Normandie im 16. und 17.Jh. mit den Hugenotten, deren Toleranzedikt von Nantes 1598 durch Heinrich IV bürgerkriegsähnliche Zustände beendete, bei denen viel Kircheninventar dran glauben musste. 1685 wurde es von Ludwig XIV aufgehoben. Damit setzte ein wirtschaftlicher Niedergang durch den Wegzug dieser Protestanten ein. Weitere Zerstörungen an Kunstschätzen gab es in der Französischen Revolution. Dem 20.Jh. begegneten wir u.a. an den Orten und Monumenten der alliierten Landung 1944. Die Zerstörungen des 2.Weltkrieges sind in vielen Städten, die wir passierten, noch deutlich zu erkennen.
Mit ca. 30.000 qkm ist die politische Normandie 1/10 größer als die Bretagne (Burgund, NRW und Katalonien sind etwas größer), hat aber mit 3 1/2 Mio. etwas weniger Bewohner als jene (4Mio.). Die haute-/basse Normandie beziehen sich nicht auf die Höhenlagen, sondern eher auf die nördliche und die südliche Normandie. Es herrscht ein mildes Meeresklima. Das strahlende Grün der Landschaft lässt auf reichlich Feuchtigkeit schließen. Selbst bei bedecktem Himmel aber scheint die Luft zu leuchten- das haben die Impressionisten, die sich oft hier aufhielten, schnell bemerkt.
Das Landschaftsbild wird (wie übrigens auch in der Bretagne) von der Bocage geprägt. Wo ausgedehnte Wälder waren, die v.a. für den Schiffbau (auch für den Kathedralenbau!) abgeholzt wurden, entstand ein Geflecht von Steinwällen, auf die Bäume und Büsche gepflanzt worden. Sie sind Jahrhunderte alt, und es gibt sie ja auch in einst keltischen Gegenden und sogar im Erzgebirge. So gibt es hier keine ausgedehnten Wälder, aber Millionen von Einzelbäumen.
Die Küche der Normandie ist mehr kräftig und bodenständig als raffiniert. Fleisch und Milchprodukte werden vorrangig hier erzeugt. Die Butter aus Isigny ist weltberühmt, beim Käse ist es das „Dreigestirn“ Camembert, der quadratische Pont l’Éveque und Livarot, das aus 32 Sorten herausragt. Aus Millionen von Äpfeln entstehen die hiesigen Spezialitäten Cidre und Calvados, wovon wir uns auch überzeugen werden. Wenn man in Frankreich „unzählig“ illustrieren will, dann sagt man: mehr als Äpfel in der Normandie. Die Nähe zum Meer sorgt natürlich auch für Krustentiere, Fisch und Muscheln.
Drei große französische Schriftsteller haben die Normandie in ihren Werken verewigt: Flaubert (Mme Bovary), Maupassant (Bel Ami) und Proust (In Swanns Welt).








Die Reise führte uns nach Katalonien. Nicht nur in dessen kulturelles und wirtschaftliches Herz Barcelona, sondern auch nach Frankreich, in dessen südlichstes Departement Roussillon - das, obwohl seit 1654 französisch, ethnisch und kulturell auch katalanisch ist. Katalanisch ist auch die Amtssprache von Andorra. So hatten wir ein verbindendes Element auf dieser Rundfahrt, die zudem in allen drei genannten Teilen zu Juwelen – zu Schönheiten der Natur und Monumenten des Weltkulturerbes führte.
Katalonien (Catalunya) im Nordosten Spaniens erstreckt sich von der Südseite der Ostpyrenäen bis ans Mittelmeer und ist eine politische Region Spaniens mit Autonomiestatut. Mit 32000 qkm ist es etwas größer als Belgien und etwas kleiner als NRW und fast genauso groß wie Burgund. Kulturell und geschichtlich erstreckt sich das Katalanische aber weiter: bis nach Valencia im Süden, über die Balearen, im Norden bis Andorra und das französische Roussillon. Mit 8 Millionen Einwohnern hat Katalonien etwa 16 % der Bevölkerung Spaniens, die Bevölkerungsdichte ist mit 234 E/qkm neun Mal so hoch wie im benachbarten Aragon. Die wirtschaftliche Stärke der hochindustrialisierten Region überschreitet den spanischen Durchschnitt erheblich.
Graf Wilfried der Behaarte (Guifré del pilos) begründete im 9. Jh. die Dynastie der Grafen von Barcelona. Um das Wappen rankt sich die Legende vom im Kampf verletzten Wilfried, in dessen Blut Kaiser Ludwig der Fromme 4 Finger tauchte und auf einem Schild „abwischte“, wodurch die 4 roten Streifen auf gelbem Grund entstanden. Ab 1137 gab es eine Staatsgemeinschaft mit dem westlich anschließenden Aragonien.
Ende des 15.Jh. wurden die Kronen Aragons und Kastiliens unter den sog. Katholischen Königen vereint. Katalonien blieb aber weitgehend eigenständig, dennoch ist seine „Mentalität“, wie behauptet wird, mit der strengen „Orthodoxie“ der Katholischen Könige und Karls V nie vereinbar gewesen, worin man auch einen Grund für das bis heute andauernde Konfliktpotenzial zwischen Kastilien und Katalonien sehen kann. Der deutlichere ist natürlich die Unterdrückung alles Katalanischen durch Franco. Katalonien war im Spanischen Bürgerkrieg 1936-39 Zentrum des Widerstandes gegen die Faschisten und hatte sogar eines der wenigen Beispiele einer anarchistischen Regierung. Die Sprache wurde verboten, alle Namen wurden „castellano“. Die wiedererlangte Autonomie nach Francos Tod 1975 hatte die Wirkung einer Wiedergeburt. Die Kultur blühte schlagartig wieder auf. Viele Namen wurden geändert, aus „Ramblas“ wurde „Rambles“, aus Figueras Figueres, aus Gerona Girona.
Dies sind einige Hintergründe für den starken Regionalismus, der in Katalonien herrscht. Man betrachtet sich als eigene Nation. Die Wahlen 2009, 2015 und 2017 können als Referenden über einen eigenen Staat gelten. Allerdings gingen 2017 auch 300.000 Katalanen für einen Verbleib bei Spanien auf die Straße. Bei den gerade stattgefundenen Wahlen erhielten die Separatisten eine schmerzliche Niederlage. Was nicht heißt, dass Barcelona und Katalonien nicht tatsächlich anders sind als Madrid und Kastilien. In Kastilien hat man den Stierkampf, in Katalonien Menschentürme (Castells) und Reigentänze (Sardana).
Barcelona, auf engem Raum zwischen Bergen und Meer gewachsen, ist mit 1,6 Mio. Einwohnern fast so groß wie Hamburg und halb so groß wie Madrid und Berlin. Es ist ein kulturelles Kraftwerk. Schon das Mittelalter schuf der Stadt des Hl. Georg (Jordi) etliche Kunstschätze. Doch es sind die Stadtplanung des 19. Jahrhunderts, die Weltausstellungen von 1888 und 1929 sowie die Olympiade 1992, die die Stadt entscheidend geprägt haben. Barcelonas Schönheit ist Architekten wie Puig i Cadafalch, Domenech i Montaner und Gaudí zu verdanken, um nur die Wichtigsten zu nennen. Sie sind Protagonisten des Modernisme, der katalanischen Entsprechung dessen, was in Wien Sezession, in Darmstadt Jugendstil und in Paris und Brüssel Art Nouveau genannt wurde. Schon ab 1880 trug der Modernisme zu einem Nationalstil bei. Barcelona war auch Schaffensort von Malern wie Miró und Dalí und auch Picasso, der hier früh wirkte. Ildefons Cerdà, der Stadtplaner des „Eixample“, jenes Stadtteils (1860 – 1910), der mehr als fünfmal so groß ist wie Barcelonas Altstadt, ist ebenfalls ein Name, der hier unbedingt genannt werden muss.
Das Barri Gothic ist das mittelalterliche Zentrum Barcelonas. Es wird von der berühmten Flaniermeile der Ramblas (Rambles, „Abschnitte“), die am Hafen bei der 70m hohen Kolumbussäule beginnt und 1,5 km bis zur Placa Catalunya verläuft, westlich begrenzt. Hier gab es die erste Stadtmauer, und die Rambles waren bis zur Pflasterung im 18.Jh. ein Sandweg, den die Befestigung hinterlassen hatte. Heute sind sie das touristische Zentrum Barcelonas, voller Gaukler, Geschäftsstände und Menschenmassen. Die heutigen Platanen sind 1859 gepflanzt.
Eng beieinander und etwas düster stehen die mittelalterlichen Bauten. Die Kathedrale La Seu und die Kirchen Santa Maria del Mar und Santa Maria del Pi (Pinienbaum) prägen die Altstadt, ähnlich wie der Königspalast mit seinem markanten Turm und der Palau de la Generalitat, aber auch heimelige Plätze. Es gibt auch mehrere Stadtpaläste, einer davon ist heute das Museu Picasso. Besonders das Frühwerk des Künstlers ist hier ausgestellt.
Der Parc Ciutadella bezeichnet den Ort, an dem die Bourbonen Teile der Altstadt abrissen, um die Zitadelle zu bauen, die dazu diente, Barcelona in Schach zu halten. Der verhasste Bau wurde 1869 geschliffen. Bis 1881 wurde hier ein Landschaftspark errichtet. Hier entstanden dann zur Weltausstellung 1888 eine Anzahl von Bauten, an denen bereits Gaudí und Domenech i Montaner beteiligt waren. Vieles der Ausstellungsarchitektur ist aber abgerissen.
Unweit der Altstadt finden sich bereits einige Highlights des Modernisme: Der Stadtpalast des Fabrikanten Güell (Gaudí, beg.1885) an der Rambles, der Palau de la Musica („Palast der Wiedergeburt Kataloniens“; „Garten Eden der katal.Musik“) von Domenech i Montaner (1905-08) und dessen Bauten im Hospital des Sta.Creu, ein Feuerwerk des Modernisme mit moderner Konstruktion, -beides heute Weltkulturerbe.
Die Placa Catalunya (mit dem Café Zürich, 1927) ist der nördliche Übergang der Altstadt zur Planstadt Eixample, mehr als fünfmal so groß wie die Altstadt (4,5x 3km), geplant von Ildefons Cerdà (1815-76). Sie macht das heutige Stadtbild Barcelonas wesentlich aus. Alle Straßen, bis auf einige Diagonalen, befinden sich parallel zum Meer oder rechtwinklig dazu. Es ergab Blöcke von jeweils 133,3m Seitenlänge. Durch die Abflachung der Ecken wurden auf jeder Kreuzung kleine Plätze geschaffen und das Abbiegen der Wagen erleichtert. Die Straßen sind mindestens 20m breit. Der Plan von 1859 wurde 1860-1910 realisiert, konzipiert für 175.000 Einwohner. Das wurden aber viel mehr, weil aus Spekulationsgründen nicht nur zwei Seiten eines Blocks bebaut wurden, sondern alle vier. Eckbauten wurden besonders hervorgehoben. Mit zusätzlich Pflastermosaiken, Straßenlaternen und Sitzbänken wurde ein Gesamtkunstwerk geschaffen.
Im Eixample entstanden über 150 herausragende Gebäude, besonders an der Prachtstraße Passeig de Gracia (So-NW) und der Granvia de les Corts Catalans (rechtwinklig dazu). Das sind u.a die Casa Mila (Gaudí 1905-11), Casa Batllò (1904-07, Gaudí), die Casa Lleo Morera („venezianischer Palast“,von Domenech i Montaner 1902-06) und 1898-1900 die Casa Amatller von Puig i Cadafalch (1867-1957). Zahlreiche Bauten schufen die drei Genies auch außerhalb von Barcelona.
Ein Höhepunkt der Eixample-Bauten ist natürlich die Kirche der Sagrada Familia, begonnen 1885, Plan erst 1906, bis heute nicht fertig. Sie soll 170m hoch werden und wirkt wie ein Gebäude aus einem Traum oder eines Fantasy-Comics.
Montjuic. Der Berg im Südwesten, der die Stadt dort vom Meer trennt, ist der Ort einer weiteren Fülle bemerkenswerter Bauten und Anlagen, die meistens mit der Weltausstellung 1929 zu tun haben. Steigt man von der Placa Espanya, die eher einen italienischen Eindruck macht (z.B. ahmen zwei dicke Türme den Campanile von Venedig nach), nach Süden an, bewegt man sich auf den mächtigen Palau Nacional zu, ein riesiges neoklassizistisches Gebäude, das das MNAC beherbergt, das Museum für katalanische Kunst mit über 260.000 Exponaten. Hier befinden sich u.a. viele der im Bürgerkrieg abgenommenen Fresken der romanischen Pyrenäen-Kirchen. Unterhalb befindet sich die Font Magica (Carles Buigas, 1929, ebenfalls Ausstellungsarchitektur) mit ihren Licht-und Wasserspielen, die aufgrund der noch immer anhaltenden dramatischen Dürre in Katalonien aber abgestellt sind. Aus dem Rahmen fällt hier der ehemalige Pavillon der Weimarer Republik von Mies van der Rohe (1929). Er ist absolute Avantgarde und verkörpert die besten Seiten der Klassischen Moderne. 1986 wurde er nachgebaut.
Hinter dem Nationalpalast befindet sich der olympische Montjuic. Sehenswert das 1992 umgebaute Olympiastadion von 1929, die „Schildkröte“ von Isozaki, der Telekommunikationsturm von Calatrava, außerdem die Fundacio Miró. Am Montjuic endet auch die Schwebebahn (1929-31), die vom Hafen kommt.
Die Belebung der Meeresfront hat viel mit der Planung für die Olympiade 1992 zu tun. Erst in der 1980er Jahren entdeckte man den Reiz, das Meer wieder ins Stadtbild einzubeziehen. Das ging auch anderen Städten so. Bis dahin verschlossen Industrie und Verkehrswege die optische Kontinuität. Straßen und Bahn verlegte man unterirdisch, und oberhalb finden sich nun breite Flanierplätze. Ehemalige Hafenbauten wandelte man um, so ehemalige Lagerhallen in das Museu d’Historia de Catalunya. Den alten Hafen (Port Vell) beherrscht heute ein riesiges Aquarium. Weiter östlich kommt man zu den Olympiabauten von 1992. Zwei Hochhäuser prägen hier die Optik, sowie der „Fisch“ (Peix) von Frank Gehry.
Bleibt noch die gegensätzliche Richtung, nach Norden, wo das Gelände schnell ansteigt. Auf dem Weg zum Parc Güell (1910-14 von Gaudí) und der Finca Güell (Gaudí 1884-87) mit dem Drachenportal kommt man auch noch an dessen Casa Vicens (1883-85) vorbei.








Rom zu einer Zeit zu besuchen, in der sich der Frühling schon fast durchgesetzt hat, zu einer Zeit, in der es weder Hitze noch Kälte gibt… das klang nach günstigen Voraussetzungen für eine Wahrnehmung der Stadt. Und so geschah es! Zumal es sich für die meisten der 20köpfigen Reisegruppe um den ersten Eindruck von dieser faszinierenden Stadt handelte.
Dieser Eindruck ist schier überwältigend. Überall die baulichen und kulturellen Zeugnisse aller Epochen quasi nebeneinander – immer wieder antike Mauern, daneben mittelalterliche Kirchen und Häuser, Brunnen und Paläste in barocker Pracht, in Rhythmus gebracht durch sanfte Hügel, deren Zahl die legendären sieben weit übersteigt, durchzogen von einer Fülle mediterraner Pflanzen. Und mittendrin der Tiber mit seinem grünen Wasser, der sich durch die Stadt schlängelt, bevor er Kurs auf das 30 km entfernte Meer nimmt.
Man kann sich angenehm verlieren an rotbraunen Wänden entlang schmaler Straßen, sich stundenlang treiben lassen. An jeder Ecke winkt eine neue Überraschung. Die Stadt wirkt unendlich. Dabei wohnen nur noch 150.000 Leute in der Altstadt, bei insgesamt 2,8 Millionen Einwohnern.
Schon vor über 500 Jahren wurde diese Stadt, deren Einwohnerzahl im 2.Jh. 1,2 Millionen betrug und bis zum Mittelalter auf wenige Tausend schmolz, wiederentdeckt. Mit der Wiedergeburt der Antike („Renaissance“) und deren Kunst und Literatur rückte der Mensch wieder in den Mittelpunkt, was das Ende des Mittelalters bedeutete. Generationen von Künstlern, nicht erst seit der Romantik, zog diese Stadt magisch an. Joachim Winckelmann, der Verfasser der Kunstgeschichte des Altertums, sagte 1756: „Außer Rom ist fast nichts Schönes auf der Welt“ und Goethe bemerkte wehmütig, nach seinem Aufenthalt in Rom nie wieder richtig froh geworden zu sein.
Und wie ist es uns ergangen?